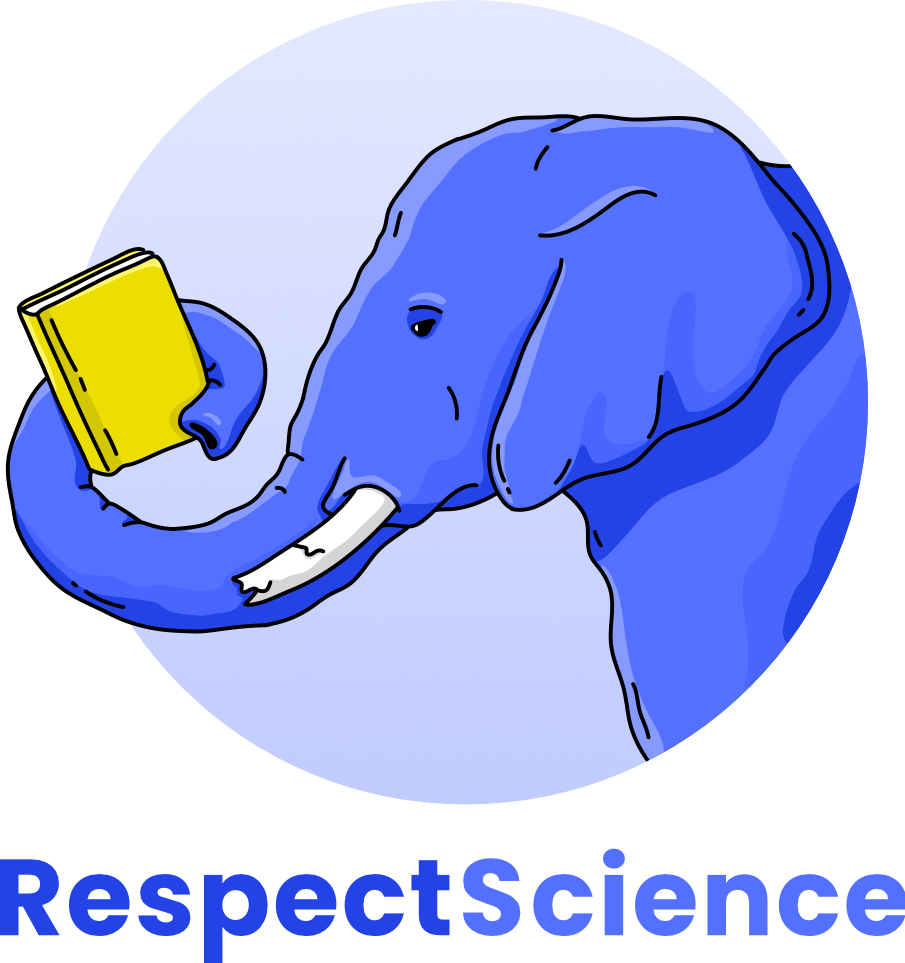2016 wurden mein Partner und ich ein Paar. Damals steckte er mitten in der Promotion und ich hatte keine Ahnung, was das für uns bedeuten würde. Wir sprachen relativ schnell über Kinder und ich bekam die Antwort: „Irgendwann will ich welche, aber im Moment kann ich es mir nicht vorstellen.“ Dass dieser Satz uns bis heute begleiten würde, war uns damals nicht klar. „Nach der Promotion wird alles besser!“ Damit vertröstete mein Partner uns immer wieder. Ich weiß, dass er das selbst geglaubt oder zumindest gehofft hat. Aber die Erfahrung hat uns eines Besseren belehrt.
Als er 2019 im Sommer seinen kompletten Jahresurlaub am Stück genommen hatte und seine Doktorarbeit endlich fertigstellen konnte, war die Hoffnung groß, dass es jetzt wirklich besser würde. Wieder mehr Zeit für uns. Ein geregeltes Leben. Weniger Stress. Und vielleicht ja auch demnächst die Familiengründung. Aber mein Partner entschied sich, zunächst in der Wissenschaft zu bleiben. Er wollte den steinigen Weg hin zur Professur wenigstens versuchen. Wir gerieten in eine Krise, ich trennte mich – kurzzeitig. Wir haben uns wieder zusammengerauft. An den Umständen hat das leider nichts geändert. Nach wie vor diktiert das Wissenschaftssystem unser Leben, da wir beispielsweise Freizeitaktivitäten und Urlaube häufig nach den Deadlines und Terminen meines Partners ausrichten müssen. Natürlich könnte man sagen: „Selbst schuld!“ Aber jede:r, der/die mit diesem System in Berührung kommt, weiß: Man kann sich dem Hamsterrad nur schwer entziehen.
“Irgendwann macht der Körper nicht mehr mit”
Lehre, Deadlines, Publikationsdruck, befristete Stellen, Drittmitteleinwerbung und noch vieles mehr hinterlässt über kurz oder lang Spuren. Die Arbeit meines Partners ist in unserem Leben allgegenwärtig. Wochenenden und Feiertage sind selten komplett frei – schnell noch eine Arbeit korrigiert, kurz eine Mail beantwortet, die letzten Quellen nachgetragen und dann fordert die Zeitschrift ungeplant eine „Major Revision“, also eine fundamentale und sehr zeitaufwändige Überarbeitung eines eingereichten Artikels. Eine fehlende/inadäquate Zeiterfassung tut ihr Übriges. Irgendwann macht der Körper nicht mehr mit – auch bei meinem Partner: Schlaf- und Verdauungsstörungen, depressive Verstimmungen, Verspannungen, Bluthochdruck und ein Hörsturz. Krank zu sein ist in diesem System aber nicht so einfach. Natürlich ist eine Krankmeldung möglich und man muss dann (hoffentlich) auch nicht bei allen Terminen erscheinen. Aber die Konsequenz daraus ist, dass die Deadlines weiterlaufen.
Und die Kinderfrage? Ja, die bleibt bis auf Weiteres ungeklärt. Denn der Wunsch meines Partners, als Vater gesund und unbefristet angestellt zu sein, ist durch die Postdoc-Phase auch weiterhin nicht gegeben. Sicherlich ist es nicht für jede:n so hart, manche Menschen sind resilienter und können mit den Gegebenheiten besser umgehen. Aber dennoch sind diese Probleme nicht nur individuelle; sie werden durch das deutsche Wissenschaftssystem mit erzeugt und von diesem und den damit zusammenhängenden Wissenschafts- und Hochschulpolitiken verstärkt. Und es werden auch nicht nur diejenigen in Mitleidenschaft gezogen, die sich dazu entscheiden, ihre Leidenschaft, ihren Idealismus, ihre Arbeitskraft und ihr Wissen dem deutschen Wissenschaftssystem zur Verfügung zu stellen, sondern es leiden auch die Partner:innen, die Kinder, die Eltern und Freundschaften darunter.
Nach fast acht Jahren, in denen ich nun die Partnerin eines Wissenschaftlers in Deutschland bin, erstaunt es mich immer noch, wie wenig Wertschätzung Wissenschaftler:innen entgegengebracht wird. Nicht nur seitens der Arbeitgeber oder der Politik; zuletzt wird auch zunehmend über Anfeindungen aus der Gesellschaft berichtet. Es wird so viel Potential vergeudet: Die Menschen arbeiten in befristeten (Teilzeit-)Verträgen, obwohl sie weit mehr als 100 Prozent und unbezahlte Überstunden leisten, müssen neben der eigentlichen Arbeit noch ehrenamtliche Tätigkeiten erledigen (zum Beispiel Gutachten, Gremienarbeit, Drittmittelanträge …), sollen für solche Stellen aber flexibel bleiben und möglichst umziehen und am Ende fliegen sie häufig aus dem System. Je nach Alter wird die Jobsuche außerhalb des Systems schwieriger – und das, obwohl sie zu den bestausgebildeten Menschen in Deutschland gehören.
Bedingungen in Academia
Ich höre immer wieder, dass die Bedingungen in Academia „nun mal so sind“. Und wenn man sich für diesen Weg entscheide, nähme man das eben in Kauf. Ich möchte dem widersprechen: Zunächst haben mein Partner und ich erst über die Jahre hinweg erahnen können, wie das deutsche Wissenschaftssystem wirklich funktioniert. Zudem möchte ich hervorheben, dass all diese Gegebenheiten nicht in Stein gemeißelt sind. Leider bewegt sich im Moment noch viel zu wenig dort, wo wirklich etwas verändert, entschieden, verbessert werden könnte. Oftmals profitieren gerade diejenigen, die etwas verändern könnten, vom aktuellen System.
Zum Glück ist die ganze Thematik in letzter Zeit verstärkt präsent, wie durch #IchBinHanna, Beiträge in den Medien, Podcasts und die politische Diskussion um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG). Leider wird meines Erachtens aber zu wenig besprochen, wie ganz konkret die Arbeitsbedingungen, die alltäglichen Probleme, Hürden und Herausforderungen für die Wissenschaftler:innen aussehen und wo der Leidensdruck für die Wissenschaftler:innen und deren Angehörige liegt. Gerade das Thema Partnerschaft, Familie und Gesundheit (neben vielen anderen) kommt aus meiner persönlichen Sicht in der Diskussion noch deutlich zu kurz.
Und während an anderer Stelle die Verantwortung vom Bund zum Land zu den Universitäten und wieder zurückgeschoben wird, fragen wir uns, wie es für uns weitergehen kann. Ich sehe die Ambitionen, den Willen etwas bewirken zu können. Ich sehe die Leidenschaft für die Forschung und die Themen sowie die Notwendigkeit, die „Fahne der Wissenschaft“ in Zeiten zunehmender Krisen, Polarisierung und Wissenschaftsfeindlichkeit hochzuhalten. Gleichzeitig sehe ich die Notwendigkeit für meinen Partner, um seiner Gesundheit und seiner Zukunft willen, das deutsche Wissenschaftssystem zu verlassen.
Die Autorin
Carolin Becker ist 34 Jahre alt und hat nach einem Lehramtsstudium in Mathematik und Biologie (1. Staatsexamen) einen Quereinstieg in die IT des öffentlichen Dienstes gemacht. Ihr Partner ist ein promovierter Wirtschaftswissenschaftler und 38 Jahre alt. Er erforscht sozialwissenschaftliche Aspekte von Nachhaltigkeitstransformationen.
Hinweis der Redaktion: Unter der Rubrik „Kommentar“ können Menschen, die sich mit dem akademischen System auseinandersetzen, einen Gastbeitrag veröffentlichen. Dies kann eine Beschreibung der eigenen Arbeit, ein Erfahrungsbericht oder ein Kommentar zu einem aktuellen Thema sein. Die Inhalte spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung von RespectScience e.V. wider.
Sie haben Stoff für einen Kommentar? Anfragen können Sie gerne über respect@science-future.de einreichen.